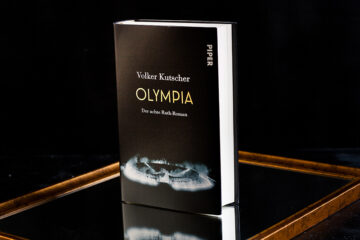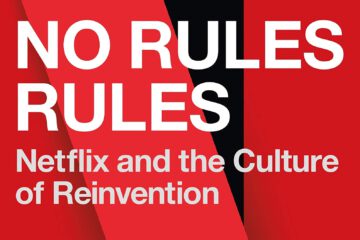Learned Optimism (1991, Ausgabe von 2006) von Martin E. Seligman
tl;dr: Ein grundlegendes Werk zum Thema Optimismus, Pessimismus und Depression, das sich damit beschäftigt, inwieweit wir trotz geerbter Veranlagung und Einflüsse unserer Umgebung auch selbst gezielt Impulse für ein glücklicheres Leben setzen können. Seligman ist einer der führenden Psychologen weltweit.
Warum sollte man ein Buch lesen, das auf englisch mit dem Untertitel „How to Change Your Mind and Your Life“ beschrieben ist und in Deutschland mit dem unsäglichen Titel „Pessimisten küsst man nicht“ heraus kam? In meinem Fall ist es ganz einfach. Die Arbeit von Seligman habe ich als wissenschaftliche Grundlage der bereits gelesenen Bücher „Emotional Intelligence“ von Daniel Goleman (mehr dazu von mir hier) und auch „Search inside Yourself“ (mehr hier) entdeckt – beide Bücher kamen ursprünglich als Führungskräfte-Fortbildung für mich auf den Tisch, haben dann aber Hunger nach mehr geweckt.
Um es gleich vorweg zu sagen: Seligman liefert, vielleicht eher sogar zu viel.
Angesichts der Fülle und der Überlappungen mit anderen Büchern zu diesen Themen folgt jetzt eine Lesehilfe/Zusammenfassung der wichtigsten Gedanken:
Wie häufig sind hier die beiden Vorworte (aus den Jahren 1997 für die erste Überarbeitung und aus dem Jahre 2006 für „mein“ Buch) extrem lesenswert, natürlich immer in chronologischer Reihenfolge – egal wie der Verlag sie druckt (leider meist das aktuelle zuerst). Seligman zeigt die gedankliche eigene Reise und die seiner Disziplin schön auf – das ist an sich schon lesenswert. Besonders seine Sicht auf die immer weiter verbreiteten, gut dokumentierten Depressionen in allen Teilen der Welt ist hilfreich: a) Depressionen sind eine Krise des „Ich“, in der wir unseren eigenen Ansprüchen und Wünschen nicht gerecht zu werden glauben. Dies passiert in einer Welt des Individualismus natürlich mehr und häufiger. b) Der Gegenfaktor „wir“ – die haltende Bindung an Familie, Nation, Religion, Nachbarschaft ist in den letzten 70 Jahren immer schwächer geworden. c) Die Antwort aus der Bewegung zu mehr Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl („Self-Esteem“) hat nicht geholfen. Kinder und Jugendliche mit immer mehr Lob, Selbstwertgefühl und Stolz zu befüllen (ich musste gleich an die unsäglichen Conni-Bücher für Kinder denken….), hilft nicht gegen spätere Depression und kann sogar Grund für eine Tendenz zu Gewalt im Erwachsenen-Leben sein, haben Studien seit Ende der 90er Jahre gezeigt. Seligmans Arbeit soll Wege aus dieser schwierigen Situation bieten und sind im Buch erläutert.
Der Band startet mit einer Erläuterung, was Optimismus und Pessimismus eigentlich sind, eingespielte Erklärungsmuster, mit denen wir unser eigenen Leben kommentieren. Dieser „explanatory style“, der sich messen und vergleichen lässt (über die Zeit und zwischen Individuen), war lange Zeit völlig außerhalb des Interesses der Psychologie. Seligman macht dann einen Ausflug in seine eigenen früheren Forschungen zum Thema erworbener Hilflosigkeit („learned helplessness“), über die er zum Thema Optimismus gekommen war.
Die Kapitel 3 und 4 zeigen dann (für mich) extrem spannende Kriterien, mit denen der Explanatory Style beschrieben werden kann. Sie starten alle mit der Frage, wie ich mir selbst Unglück in meinem Leben deute:
- Dauer: Erkläre ich Unglück als einmalig oder als eine dauerhafte Sache?
- Gültigkeit: Erkläre ich Unglück als Einzelfall oder Beweis universeller Probleme?
- Internalisierung: Erkläre ich Unglück als durch mich/mein Verhalten verursacht oder durch andere Menschen?
Selbstverständlich kann man „herumgedreht“ alle diese Kriterien auch für die Erklärung guter Erlebnisse definieren. Seligmann gibt unzählige Beispiele und bietet einen aufwändigen Selbsttest an, um die eigenen Neigungen zu testen. Eine deutliche Neigung oder Phase, unglückliche Dinge im eigenen Leben aus dauerhaft, als größeres Problem und als selbst verursacht zu deuten, ist nah an leichten depressiven Phasen, aber Seligman zeigt auf, dass die Beziehung zwischen Depressionen und Pessimismus komplexer ist:
- Bipolare Störungen sind Krankheiten des Körpers und können durch Medikamente (zum Teil) behandelt werden.
- Unipolare Depressionen sind manchmal erblich und können auch zum Teil durch Medikamente behandelt werden, allerdings nicht so erfolgreich wie bipolare Störungen
- Die meisten Depressionen (besonders die starke Ausweitung der Verbreitung unter Menschen in der westlichen Welt seit dem 2. Weltkrieg) sind nicht erblich und auch nicht erklärbar durch physische Veränderungen unserer Ernährung oder Umwelt. Hier folgt nun der Link zu Seligmans früheren Forschungen zu erlernten Hilflosigkeit: Depressionen können durch Niederlagen, Scheitern oder Verluste im Leben und deren Deutung als unkrontollierbare Vorgänge UND die Einschätzung, dass aktives Handeln sowieso nicht helfen wird, verursacht sein.
Hier setzt seine Hoffnung an: Durch Veränderung der eigenen Erklärungsmuster, der eigenen Deutungen unseres Lebens, können wir uns von der Verletzlichkeit der Depressionen etwas lösen, als Gesellschaft und als Einzelne. Das ist genau, was auch Kognitive Verhaltenstherapie gegen Depressionen zu tun sucht.
Seligmann macht nun noch einen interessanten Ausflug zu der Frage, warum Frauen im Verhältnis 2:1 mehr als Männer von Depressionen heimgesucht werden. Es ist nicht vollständig erforscht, aber die Neigung zum Grübeln („Rumination“) oder positiver ausgedrückt zum Reflektieren des eigenen Lebens, ist bei Frauen stärker, sowohl bei Optimistinnen als auch bei Pessimistinnen – dies führt aber zu stärkeren Folgen für die mentale Gesundheit, während Männer sich „schlechte“ Gedanken öfter als Frauen durch physische Aktivität, Drogen (Alkohol u.a.) oder Gewalt aus dem Kopf verjagen. Eine Frage, der er nicht nachgeht: Kann es nicht sein, dass wir Jungs schon klein auf andere Explanatory Styles beibringen als Mädchen, bewusst und unbewusst? Jungs, die heulend bei Regen mit 5 Jahren auf dem Fussball-Platz durchhalten sollen und Mädchen, die beim Ballett-Unterricht von ihren Großmüttern gefilmt und Lob überhäuft werden, kommen mir da in den Sinn…
Im zweiten Teil des Buches geht Seligman verschiedene Lebensbereiche („Realms“ – ein schönes englisches Wort) durch und berichtet von Anwendungen der dargelegten Theorien, insbesondere von Umfragen, empirischen Studien u. ä., die zu dem jeweiligen Bereich passen. Die Bereiche sind a) Erfolge im Arbeitsleben, b) Kindererziehung, c) Erziehungswesen, d) Leistungs- und Profisport, e) Gesundheit sowie auch f) Geschichte (am Beispiel der Präsidentschaftswahlen der letzten Jahrzehnte in den USA, Auswertung von Reden usw.). Alle Kapitel sind für sich allein lesenswerte Abhandlungen – Seligman scheint durch seine prominente Rolle in der Szene immer Mitarbeiter, Netzwerke und Geldmittel für aufregende, breit- und langfristig angelegte Studien gehabt zu haben, er berichtet aber auch über die Forschungsergebnisse von Kolleg*innen.
Im dritten und letzten Teil stellt Seligman noch einmal übergreifend Wege vor, wie Optimismus gelernt werden kann (der Titel des Bandes!). Für die eigene Praxis stellt er die sog. ABC, bzw. ABCDE-Methode, mit der man im Alltag die Verarbeitung von äußeren Eindrücken und Vorfällen beobachten und sich dann selbst herausfordern kann, neue Wege zu gehen. Eine Beschreibung würden den Platz hier sprengen. Danach geht er noch einmal auf die Kindererziehung ein – ein gleicher Weise wie Kinder durch das Vorbild und Feedback ihrer Eltern Hilflosigkeit und pessimistische Deutungsmuster erlernen, können sie im weiteren Verlauf ihres Lebens grundsätzlich diese durch anderes Feedback, andere Interaktionen wieder ablegen – eine umheimlich positive Schlussfolgerung auf Basis des Forschungsstands, die auch meinem eigenen Menschenbild, dass Menschen grundsätzlich zu bewusster Veränderung (zum Besseren) fähig sind, entspricht. Auch die Anwendung der ABCDE-Methode im beruflichen Umfeld wird noch einmal ausführlich erläutert – sehr treffend die dabei (nebenbei) berichteten Analysen, dass in großen Organisationen die Pessimisten und Optimisten ungleich verteilt sind. Die allen bekannten Vorurteile zwischen Vertrieb und Buchhaltung oder zwischen F&E und Betriebssicherheit-Funktionen basieren auf messbaren Unterschieden in der Weltdeutung, die die Menschen in den jeweiligen betrieblichen Funktionen aufweisen.
Im Abschluss kommt Seligman noch einmal auf seine Diagnose der „Depressions-Epidemie“ der westlichen Welt zu sprechen. Während es for die seelische Gesundheit (meine Übersetzung von „mental health“…) wünschenswert wäre, dass die Balance zwischen Individualismus und gemeinschaftlichem Handeln wieder etwas zurück geschoben wird, hat sich sein Buch mit dem anderen Wege, den er nun (plötzlich) „Maximal Self“ nennt, beschäftigt – als ein Oberbegriff für das Bemühen, dass möglichst viele Menschen auf Basis einer optimistischen Weltsicht ein glückliches Leben führen können (besonders auch, wenn es kein Zurück aus dem heute vorherrschenden Individualismus geben sollte).
Mein Fazit: Ein starkes Buch, das mein Verständnis von Depression und den Unterschieden, wie Menschen die Welt sehen, stark verbessert hat. Die vielen angebotenen Selbsttests und Übungen im Verlauf des Buches habe ich auch großteils mitgemacht, davon aber wenig abgewinnen können, da ist jede*r ander. Leider gibt es keine online-Versionen davon, das scheint alles als Arbeitsmaterial von Privatunternehmen oder ausgebildeten Psychologen außerhalb des direkten Zugriffs für die Öffentlichkeit zu sein.